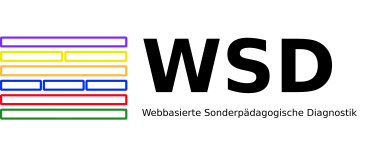3-Stufen-Modell der Lesekompetenzen nach Rosebrock und Nix
Zitiervorschlag: Mezger, K. (2025). „3-Stufen-Modell der Lesekompetenzen nach Rosebrock und Nix“. Abgerufen von URL: https://wsd-bw.de/doku.php?id=wsd:lesen_schreiben:rosebrock, CC BY-SA 4.0
Das im Folgenden dargestellte „Didaktische Modell der Lesekompetenz“ nach Rosebrock und Nix (2017) geht davon aus, dass Lesen eine Summe aus vielen Teilfähigkeiten darstellt. Diese Teilfähigkeiten sind auf drei unterschiedlichen Ebenen angesiedelt, der Kognition, der Persönlichkeit sowie der sozialen Situation der Lesenden.
Zitiervorschlag: Grafik „Didaktisches Modell der Lesekompetenz“ nach Rosebrock, C. und Nix, D. (2017). Abgerufen von URL: https://wsd-bw.de/lib/exe/fetch.php?cache=&media=wsd:lesen_schreiben:modell_lesekompetenz.png, CC BY-SA 4.0
Die kognitiven Leistungen, die beim Lesen erbracht werden müssen, sind im oberen Drittel des Modells, auf der sogenannten Prozessebene, dargestellt. Sie bilden die Basis, um Lesen im eigentlichen Sinn überhaupt zu ermöglichen. Dabei unterscheidet man auf der Prozessebene zwischen hierarchieniedrigen und hierarchiehöheren Prozessen. Zu den hierarchieniedrigen Fähigkeiten gehört das genaue und automatisierte Erkennen von Wörtern und kurzen Sätzen – also das flüssige Lesen (auch Leseflüssigkeit oder fluency genannt). Dabei kommt es auf eine angemessene Lesegeschwindigkeit sowie auf eine sinngerechte Betonung an. Erst wenn diese grundlegenden Prozesse sicher beherrscht und automatisiert sind, kann auf der hierarchiehöheren Prozessebene das Leseverständnis, also das sinnentnehmende Lesen aufgebaut werden.
Die zweite Ebene des Modells, die Subjektebene, beschreibt die persönlichen Voraussetzungen und Einstellungen, mit denen Leserinnen und Leser an einen Text herangehen. Dazu zählen ihre Motivation, Emotionen und ihr Vorwissen sowie die Bereitschaft, über das Gelesene nachzudenken und es mit der eigenen Meinung abzugleichen. Jede Person entwickelt im Laufe der Zeit ein Leseselbstkonzept, das durch eigene Erfahrungen, Einstellungen und Gefühle beeinflusst wird. Dieses Selbstbild wirkt sich unmittelbar auf die Lesemotivation aus.
Auf der dritten Ebene, der sozialen Ebene, geht es um Lesen und soziale Interaktion. Ob Kinder und Jugendliche eine Freude am Lesen entwickeln und ein nachhaltiges Interesse an Büchern, literarischen Werken oder digitalen Texten aufbauen, wird stark vom sozialen Umfeld geprägt. Die Forschung zur Lesesozialisation zeigt, dass Bezugspersonen und soziale Gruppen eine entscheidende Rolle beim Heranwachsen junger Leserinnen und Leser spielen. Lesesozialisation beschreibt den Prozess, bei dem Menschen lernen, Lesen als regelmäßigen Bestandteil ihres Lebens zu begreifen. Dieser Prozess beginnt meist im frühen Kindesalter und begleitet die Menschen ein Leben lang. Er wird durch viele Faktoren beeinflusst, wie etwa die Familie, Bildungseinrichtungen, das soziale Umfeld sowie kulturelle Erfahrungen und Kontexte.
| Ebene | Beispiele (vgl. Rosebrock 2012) |
|---|---|
| Prozessebene Ebene der Lesetechnik (Kognitive Ebene ) | |
| Hierarchieniedrigere Prozesse: Wort- und Satzidentifikation | Was bedeutet das Wort „Regen“? Was macht die Person? „Einen Regenschirm benutzen“? |
| Hierarchieniedrigere Prozesse: Lokale Kohärenz | Grammatische Zusammenhänge im Satz erkennen, z. B.: Was bedeutet „trotzdem“? |
| Hierarchiehöhere Prozesse: Globale Kohärenz | Wovon handelt der Text insgesamt? |
| Hierarchiehöhere Prozesse: Superstrukturen erkennen | Auseinandersetzung mit Strukturmerkmalen des Textes (sprachliche Bilder, Ironie, Reime) und der Textsorte (Gedicht, Märchen) |
| Hierarchiehöhere Prozesse: Darstellungsstrategien identifizieren | Was will der Text insgesamt erreichen? Worum geht es dem Text (z. B. Werbung)? |
| Subjektebene | |
| Wissen | Was bedeutet das Wort „Rettungsschirm“? |
| Beteiligung | Wie fühlt sich Person XY? |
| Motivation | Ist der Text interessant, spannend, lustig? |
| Reflexion | Stimmt die Aussage des Textes? |
| Soziale Ebene | |
| Familie | Stellenwert von Lesen in der Familie |
| Schule | Anschlusskommunikation, Interaktion |
| Peers | Buchempfehlungen, Interaktion |
| Kulturelles Leben | Besuch von Bücherei oder Lesungen |
Literatur
Rosebrock, C. & Nix, D. et al (2011). Leseflüssigkeit fördern. Lautleseverfahren für die Primar‐ und Sekundarstufe. Seelze: Friedrich Verlag. (inkl. CD mit Lehrfilmen).
Rosebrock, C. (2012). Was ist Lesekompetenz, und wie kann sie gefördert werden? Abrufbar unter: https://www.leseforum.ch/myUploadData/files/2012_3_Rosebrock.pdf
Layout und Gestaltung: Christian Albrecht, Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung (ZSL) Baden-Württemberg