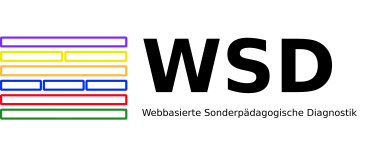Förderschwerpunktspezifische Aspekte von Motorik und Bewegung - Förderschwerpunkt Hören
Zitiervorschlag: Rauner, R. (2025). „Förderschwerpunktspezifische Aspekte von Motorik und Bewegung - Förderschwerpunkt Hören“. Abgerufen von URL: https://wsd-bw.de/doku.php?id=wsd:selbststaendiges_leben:themenfeld:theorien_bewegung:aspekte_fsp_hoeren, CC BY-SA 4.0
Die Hörschädigung als Beeinträchtigung der Wahrnehmung hat Auswirkungen auf die Gesamtentwicklung von Kindern und Jugendlichen, wobei auch die motorische Entwicklung beeinträchtigt sein kann.
Es liegen nach wie vor wenige Studien zum Thema vor, im Allgemeinen zeigen Untersuchungen aber in vielen Bereichen Nachteile für Kinder mit Hörschädigung im Bereich Motorik. Kosel (1981) beschreibt in einer Metaanalyse vor allem Schwierigkeiten in Bezug auf die Grob- und Feinkoordination, die Bewegungskopplung und das motorische Gleichgewicht sowie auf das Bewegungsgefühl.
Engel-Yeger und Weissman (2009) fanden bei Kindern mit Hörschädigung Defizite in der Handgeschicklichkeit, in Ballfertigkeiten und bei statischen und dynamischen Balanceaufgaben.
Eine Beeinträchtigung im Bereich der Motorik kann einerseits damit begründet werden, dass die auditive Wahrnehmung des Menschen sowohl als Anreiz- als auch als Informations- und Warnsystem fungiert. Da Kinder mit Hörschädigung je nach Ausprägung ihres Hörvermögens akustische Reize verändert, abgeschwächt oder gar nicht wahrnehmen, reagieren sie auf diese Reize in früher Kindheit entweder wenig oder gar nicht mit den entsprechenden Bewegungen. Auch erleben sie häufig Überraschungsmomente oder Situationen, in denen sie erschrecken, da sie die vorangegangenen akustischen Ereignisse nicht wahrnehmen. Oftmals hemmen diese Erfahrungen den natürlichen Drang der Kinder und Jugendlichen, ihren Bewegungsradius zu erweitern, zu forschen und zu entdecken, was einen Einfluss auf die motorische Entwicklung haben kann.
Ein weiterer entscheidender Faktor für Schwierigkeiten im Bereich Motorik bei Kindern mit Hörschädigung scheint die Schädigung des Vestibulärapparates, mit der oft eine Störung des Gleichgewichtsorgans einhergeht, zu sein (vgl. Crowe & Horak 1988). Es gibt aber auch Hinweise darauf, dass motivationale Aspekte, die sich durch fehlende verbale Unterstützung bei der Bewegungsausführung ergeben, als Ursache für schlechtere Ergebnisse hörgeschädigter Kinder im Bereich Motorik mit verantwortlich sein können (vgl. Auguste & Lichtner 2014). Zudem können weitere Umweltfaktoren, wie zum Beispiel die Einstellung der Familien der Kinder in Bezug auf die Bedeutsamkeit von Bewegung und sportlicher Betätigung, hier eine Rolle spielen.
Auch bei sportlicher Betätigung stellt das Hören eine wichtige Informationsquelle dar. Bei Kindern mit Hörschädigung sind im Lehr- / Lernprozess verbale Informationen (z. B. für Bewegungsbeschreibungen und -korrekturen, taktische Anweisungen, Motivation zur Bewegung), aber auch sensorische Rückmeldungen bei der der Bewegungsausführung (Bewegungsdifferenzierung, Richtungsortung, Entfernung von Schallquellen) teilweise deutlich eingeschränkt (vgl.Auguste & Lichtner 2014).
Literatur
Auguste, C. & Lichtner, H. (2014). Die sportmotorische Leistungsfähigkeit hörgeschädigter Grundschulkinder. In: Motorik 1/2014
Crowe, T., Horak, B. (1988). Motor proficiency associated with vestibular deficits in children with hearing impairments. Journal of The American Physical Therapy Associations 68, 1493–1499.
Engel-Yeger, B., Weissman, D. (2009). A comparison of motor abilities and perceived self-efficacy between children with hearing impairments and normal hearing children. Disability and Rehabilitation 31, 352–358.
Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung (2025). Bildungs- und Erziehungsauftrag für den Förderschwerpunkt Hören. Abrufbar unter: https://www.lehrplanplus.bayern.de/bildungs-und-erziehungsauftrag/foerderschule/foerderschwerpunkt/hoeren#241796
Layout und Gestaltung: Christian Albrecht, Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung (ZSL) Baden-Württemberg