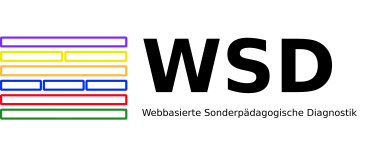Inhaltsverzeichnis
Funktion und Bedeutung von Bewegung für die kindliche Entwicklung
Zitiervorschlag: Gromer, B. (2025). „Funktion und Bedeutung von Bewegung für die kindliche Entwicklung.“ Abgerufen von URL: https://wsd-bw.de/doku.php?id=wsd:selbststaendiges_leben:themenfeld:theorien_bewegung:bedeutung_bewegung
Bewegung ist als elementares Grundbedürfnis des Menschen zu verstehen, dessen Befriedigung eine zentrale Voraussetzung für Gesundheit, Entwicklung und Wohlbefinden darstellt. Darüber hinaus fungiert Bewegung als fundamentale Handlungs- und Ausdrucksform des Menschen. Sie umfasst nicht nur die Fähigkeit zur Fortbewegung oder zum physischen Überleben, sondern ist ein zentrales Medium der Selbst- und Welterfahrung. Über Bewegung treten Menschen in Beziehung zu ihrer natürlichen und sozialen Umwelt sowie zu sich selbst. Sie bildet damit die Grundlage für die Entwicklung von Körperbewusstsein, Identität und Autonomie. Bewegung ermöglicht die aktive Aneignung von Welt und die reflexive Auseinandersetzung mit ihr. Insbesondere im Kindesalter, aber auch über die gesamte Lebensspanne hinweg, stellt Bewegung ein wesentliches Mittel dar, um sich Umwelt zu erschließen, individuelle Fähigkeiten zu erproben und soziale Interaktionen zu gestalten (vgl. Zimmer 2020 u. 2021; Stemme et al. 1998).
Im Kindesalter stellt Bewegung die zentrale Betätigungsform dar und gilt als Motor der kindlichen Entwicklung und des kindlichen Lernens. Mit Hilfe von Körper- und Sinneserfahrungen gewinnt ein Kind Erkenntnisse über seine Umwelt, lange bevor es sprachliche Begriffe dafür kennt oder aktiv gebraucht. Im konkreten Bewegungshandeln lernt ein Kind Ursachen und Wirkungszusammenhänge kennen und gewinnt Informationen über die Eigenschaften z.B. von Personen und Gegenständen (vgl. Zimmer 2020, 2021).
(Bewegungs-) Erfahrungen mit dem eigenen Körper bilden die Grundlage für die Ich-Entwicklung. An den eigenen motorischen und körperlichen Fähigkeiten erkennt ein Kind die Möglichkeiten wachsender Selbstständigkeit und Unabhängigkeit. Die Entwicklung der Selbstständigkeit zeigt sich z.B. durch Formen des selbstständigen Fortbewegens, die völlig neue Handlungs- und Erfahrungsspielräume schaffen.
Durch Erfahrungen mit dem eigenen Körper entwickelt ein Kind Vorstellung über die eigenen Kompetenzen und das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. Zudem kann es Rückschlüsse auf sich, als Verursacher von Handlungen und Effekten ziehen. Das Erleben von Selbstwirksamkeit ist die Basis von Selbstvertrauen (vgl. Zimmer 2021).
Wahrnehmung, Bewegung und Bewegungshandeln sind eng verbunden mit kognitiven Prozessen und unterstützen die Entwicklung des Gehirns und den Verknüpfungen von Nervenzellen innerhalb des neuronalen Netzwerks des Menschen. Die genetische Anlage eines Kindes bestimmt zwar den Prozess der neuronalen Entwicklung, die Qualität dieser Entwicklung ist aber maßgeblich durch Umweltfaktoren, z.B. durch die Möglichkeit zur eigenen Handlungserfahrung, geprägt. Neuere Forschungen zeigen zudem auf, dass durch körperliche Aktivität und Bewegung die kognitive Kontrolle von Verhalten und Aufmerksamkeit (exekutive Funktionen) beeinflusst werden können (vgl. Zimmer 2021; Pickler & Tardos 2018).
Bedeutungsdimensionen von Bewegung
1. Die instrumentelle Bedeutung beschreibt den Werkzeugcharakter von Bewegung. Im Alltag wird Bewegung funktional und instrumentell eingesetzt. Dadurch kann etwas erreicht, hergestellt, ausgedrückt, dargestellt und durchgesetzt werden (z.B. Gegenstände handhaben, sich ankleiden, sich fortbewegen, spielen, Sport machen…).
2. Die wahrnehmend-erfahrende Bedeutung meint die Bewegungen durch die eine Person etwas über die eigene Körperlichkeit, über die materielle Beschaffenheit der Umwelt und über Personen der eigenen Umgebung erfahren kann. Die Erfahrungssuche und der daraus resultierende Erfahrungsgewinn läuft entweder willentlich gesteuert und gezielt, aber auch beiläufig und intuitiv statt.
3. Die soziale Bedeutung beschreibt die kommunikative Funktion von Bewegung, indem durch diese Beziehung und Kontakt zu anderen Personen aufgenommen wird (z.B. winken, sich die Hand geben, sich berühren, sich umarmen, auf Distanz gehen…). Diese Formen gehören zu sozialen Ritualen, die erlernt werden müssen.
4. Die personale Bedeutung umfasst die Möglichkeiten von Bewegung etwas über sich selbst zu erfahren, sich selbst zu erleben, aber auch sich zu verwirklichen, zu verändern und weiterzuentwickeln (vgl. Grupe 1992, zitiert nach Zimmer 2020).
Funktionen von Bewegung
In Anlehnung an die oben dargestellten Bedeutungsdimensionen können verschiedene Funktionen von Bewegung ausdifferenziert dargestellt werden. Diese stehen im Alltag in Beziehung zu einander, bedingen sich ggf. gegenseitig und sind entweder direkt oder auch indirekt miteinander verbunden. Häufig ergänzen sich einzelne Aspekte auch oder überlagern sich gegenseitig. In einer Handlung werden meistens verschiedene Funktionen realisiert.
Zitiervorschlag: Grafik „Funktionen von Bewegung nach Zimmer (2020)“ von Gromer, B. (2025). Abgerufen von URL: https://wsd-bw.de/doku.php?id=wsd:wsd:selbststaendiges_leben:themenfeld:theorien_bewegung:bedeutung_bewegung, CC BY-SA 4.0
personale Funktion:
- Sich selbst und den eigenen Körper kennenlernen.
- Sich mit der eigenen Körperlichkeit und den eigenen körperlichen Fähigkeiten auseinandersetzen.
- Ein Selbstbild entwickeln.
soziale Funktion:
- Mit anderen etwas gemeinsam tun.
- Miteinander und gegeneinander spielen.
- Sich mit anderen absprechen (z.B. Regeln, Vorhaben).
- Nachgeben und sich durchsetzen.
produktive Funktion:
- Mit dem eigenen Körper etwas erschaffen, etwas herstellen.
- Bewegungsfertigkeiten erwerben und entwickeln (z.B. Fahrrad fahren, Balancieren, Zielwerfen…).
expressive Funktion:
- Gefühle, Empfindungen, in und durch Bewegung ausdrücken.
- Emotionen körperlich ausleben, regulieren und verarbeiten.
impressive Funktion:
- Lust, Freude, Erschöpfung, Energie und Zufriedenheit durch Bewegung spüren.
explorative Funktion:
- Sich mit Gegenständen und Objekten auseinandersetzen und ihre Eigenschaften verinnerlichen.
- Die dingliche und räumliche Umwelt erkunden und sich erschließen.
- Sich Umweltanforderungen anpassen, bzw. sich eine Situation passend machen.
komparative Funktion:
- Sich mit anderen vergleichen.
- Sich mit anderen messen und wetteifern.
- Erfolge erleben und Niederlagen verarbeiten lernen.
adaptive Funktion:
- Die eigenen körperlichen Grenzen kennen lernen.
- Die eigene Leistungsfähigkeit steigern.
- Belastungen erfahren und ertragen.
- Sich selbst Ziele und Anforderungen setzen und mit von außen gesetzten Zielen und Anforderungen umgehen (vgl. Zimmer 2020).
Literatur
Pickler, E. & Tardos, A. (2018). Laßt mir Zeit. Die selbständige Bewegungsentwicklung des Kindes bis zum freien Gehen. München: Pflaum.
Stemme, G., Eickstedt, D. von & Laage-Gaupp, A. (2012). Die frühkindliche Bewegungsentwicklung. Vielfalt und Besonderheiten. Düsseldorf: verlag selbstbestimmtes leben.
Zimmer, R. (2020). Handbuch Bewegungserziehung. Grundlagen für Ausbildung und pädagogische Praxis. Freiburg im Breisgau: Herder.
Zimmer, R. (2021). MotorikPlus. Beobachtung psychomotorischer Kompetenzen von Kindern im Alltag von Kindertageseinrichtungen. Freiburg im Breisgau: Herder.
Layout und Gestaltung: Christian Albrecht, Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung (ZSL) Baden-Württemberg