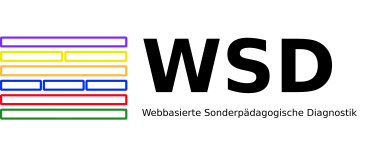Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Zusammenhänge zwischen sprachlichen Fähigkeiten und sozial-emotionaler Entwicklung
Zitiervorschlag: Stather, L. (2025). „Zusammenhänge zwischen sprachlichen Fähigkeiten und sozial-emotionaler Entwicklung.“ Abgerufen von URL:https://wsd-bw.de/doku.php?id=wsd:kommunikation:sprache_emotion|, CC BY-SA 4.0
Bei sprachlichen Auffälligkeiten treten häufig als Sekundärsymptomatik auch Auffälligkeiten im sozial-emotionalen Bereich auf. Ebenso ist zu beobachten, dass Kinder und Jugendliche mit Auffälligkeiten im sozialen-Bereich auch sprachliche Auffälligkeiten haben (vgl. Hillenbrand 2014). In etlichen Studien wird das Risiko zu externalisierendem und/oder internalisierendem Verhalten bei Sprachentwicklungsstörungen aufgezeigt (vgl. Schramm et al. 2024). Internationale Studien zeigen bei Kindern mit Sprachentwicklungsstörungen im Verlauf häufig ein reduziertes Selbstwertgefühl, ein geringes Maß an Autonomie und ein erhöhtes Maß an Schüchternheit sowie problematische Peer-Beziehungen (vgl. Mayer et al. 2024).
Aktuelle Studien zeigen eine hohe Auftretenshäufigkeit von Einschränkungen im Bereich des Wortschatzes und der Grammatik mit Auffälligkeiten im sozial-emotionalen Bereich, wobei vor allem der rezeptive Wortschatz in engem Zusammenhang mit externalisierendem Verhalten steht. Viele Kinder und Jugendliche haben zudem Einschränkungen im pragmatisch-kommunikativen Bereich (vgl. Mayer et al. 2024).
Mögliche Hypothesen hierzu sind, dass Kinder und Jugendliche mit sprachlichen Auffälligkeiten weniger kommunikative Teilhabe erfahren und sich außerdem auch als wenig selbstwirksam erleben (vgl. Ulrich et al. 2024).
In einer Studie von Hollo (vgl. Ulrich et al. 2024) zeigten 81% der Kinder und Jugendlichen mit Auffälligkeiten im sozial-emotionalen Bereich auch sprachliche Auffälligkeiten, die bis zu diesem Zeitpunkt nicht diagnostiziert waren.
Mögliche Hypothesen hierzu sind, dass die Sprachverarbeitungsprozesse durch das erhöhte Stresserleben beeinträchtigt sind. Eine eingeschränkte Aufmerksamkeit beeinflusst zudem negativ die auditive Wahrnehmung und Verarbeitung der Sprache. Zudem können durch das Verhalten bedingt verringerte sozial-kommunikative Interaktionen weiterhin den Ausbau der Sprachkompetenzen hemmen (vgl. Ulrich et al. 2024).
Die häufig stark fordernden sozial-emotionalen Auffälligkeiten bergen das Risiko, dass mögliche sprachliche Einschränkungen in den Hintergrund treten, insbesondere wenn die sprachlichen Auffälligkeiten den rezeptiven Bereich betreffen oder Kompensationsstrategien des Kindes/Jugendlichen eingesetzt werden, um Kommunikationssituationen auszuweichen oder zu bewältigen (vgl. Mayer et al. 2024).
Zusammenfassend lässt sich festhalten: Es braucht eine Sensibilisierung bezüglich des Zusammenhangs zwischen sprachlichen Fähigkeiten und sozial-emotionalem Verhalten. Sprachliche Einschränkungen können dazu führen, dass Peer-Beziehungen bzw. kommunikative Interaktionen nicht entstehen oder konfliktreich sind. Zudem können eigene Bedürfnisse, Gefühle, Meinungen nicht angemessen versprachlicht werden. Pragmatische Einschränkungen führen zu Einschränkungen im Gesprächsverhalten. Konflikte können nicht sprachlich gelöst werden (vgl. Hillenbrand 2014, Mayer et al 2024, Schramm et al 2024).
Die im Folgenden aufgeführten Maßnahmen dienen in diesem Zusammenhang der gezielten Förderung sprachlicher Fähigkeiten.
Maßnahmen zur Förderung sprachlicher Fähigkeiten • Förderung des Wortschatzes • Einüben von Interaktionsverhalten in kommunikativen Situationen • Reflexion von Interaktionen bei Konflikten • Förderung des Textverständnisses Link zu: https://wsd-bw.de/doku.php?id=wsd:didaktisierung:vereinfachung_lesetexte • Sprachsensibel Unterrichten Link zu: https://wsd-bw.de/doku.php?id=wsd:didaktisierung:sprachsensibler_mathematikunterricht • Resilienzförderung
Literatur
Bloom, L. & Lahey, M. (1978). Language development and language disorders. New York: Wiley
Leber, I. (2017). Kommunikation einschätzen und unterstützen. Begleitheft und Poster zu den Fördermöglichkeiten in der Unterstützten Kommunikation. Karlsruhe: von Loeper
Rowland, C. & Stremel-Campbell, K. (1987). Share and Share Alike: Conventional Gestures to Emergent Language for Learners with Sensory Impairments. In L. Goetz, D. Guess & K. Stremel-Campbell (Hrsg.). Innovative program design for individuals with dual sensory impairments. Baltimore: P.H. Brookes Pub. Co.
Rowland, C. (2011). Using the Communication Matrix to Assess Expressive Skills in Early Communicators. Communication Disorders Quarterly 32 (3)
Rowland, C. (2015). Die Kommunikationsmatrix. Deutsche Übersetzung: Scholz, M. & Jester, M.: https://communicationmatrix.org/Content/Translations/Communication_Matrix_German_FINAL.pdf
Sclera NPO (2022). Sclera Symbols. Zugriff am 10.06.2022. Verfügbar unter: www.sclera.be/
Scholz, M. & Stegkemper, J. (2022). Unterstützte Kommunikation: Grundfragen und Strategien. München: Ernst Reinhardt
Layout und Gestaltung: Christian Albrecht, Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung (ZSL) Baden-Württemberg