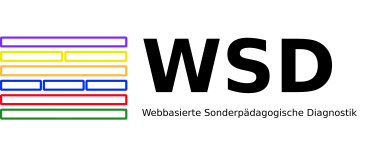Lebenspraktische Fähigkeiten (LPF)
Zitiervorschlag: Wilhelm, R., Rauner, R. & Köwing, G.(2025). „Lebenspraktische Fähigkeiten (LPF).“ Abgerufen von URL: https://wsd-bw.de/doku.php?id=wsd:selbststaendiges_leben:themenfeld:bildungsangebote_versorgung:lpf
Im Bildungsbereich „Lebenspraxis“ betont der Bildungsplan der Schule für Blinde und Sehbehinderte Baden-Württemberg (2011) die Bedeutung des Erwerbs Lebenspraktischer Fähigkeiten für blinde und sehbehinderte Menschen. Ziel ist es, die Entwicklung von Selbstständigkeit zu fördern, um ein stärkeres Selbstwertgefühl sowie einen selbstbewussteren Umgang mit der Umwelt zu ermöglichen. Damit trägt der Auf- und Ausbau Lebenspraktischer Fähigkeiten wesentlich zur Aktivität und Teilhabe an gesellschaftlichen Prozessen bei. Deshalb ist es Aufgabe der Schule, die Schüler:innen in enger Abstimmung mit dem häuslichen Umfeld bei der Ausbildung von Strukturen, Routinen und Fertigkeiten zur Bewältigung ihres Alltags zu begleiten und Fachleute für Rehabilitation im Bereich Lebenspraktische Fähigkeiten einzubeziehen.
Lebenspraktische Fähigkeiten sind entscheidend für die erfolgreiche Bewältigung der täglichen Anforderungen und tragen gleichzeitig maßgeblich dazu bei, ein unabhängiges und erfülltes Leben zu führen. Daher können Lebenspraktische Fähigkeiten als Schlüssel zur sozialen Kompetenz im Alltag von Menschen mit Blindheit oder Sehbehinderung bezeichnet werden (vgl. Hergert & Hofer 2011).
Unterricht in Lebenspraktischen Fähigkeiten (LPF) ist deshalb besonders bedeutsam für blinde und hochgradig sehbehinderte Kinder, weil sie die für sehende Kinder typische unbewusste, visuell gesteuerte Nachahmung von Alltagshandlungen nicht durchführen können. Da diese Imitation eine zentrale Rolle beim Erwerb motorischer Fähigkeiten spielt, benötigen diese Lernprozesse gezielte Unterstützung (vgl. Hergert & Hofer 2011; Hofer 2017). Der Unterricht in Lebenspraktischen Fähigkeiten findet daher immer in einer Einzelsituation statt und wird durch Rehabilitationslehrkräfte für Lebenspraktische Fähigkeiten durchgeführt. Die enge Absprache mit Lehrkräften und Erziehungsberechtigten sichert die Umsetzung der erlernten Strategien im Rahmen des Unterrichts oder im Alltag der Kinder. Nur durch diese kontinuierliche Anwendung der Techniken kann ein nachhaltiges Lernen gesichert werden.
Zu den zentralen Inhalten im Kontext Lebenspraktischer Fähigkeiten gehören Techniken aus den folgenden Bereichen (vgl. Walthes 2005; Hergert & Hofer 2011):
- Wohn- und Essenssituationen
- Ernährung: Einkauf und Arbeitsbereich Küche
- Haushaltsgestaltung und Reinigung
- Kleidung und Kleiderpflege
- Hygiene und Gesundheit, Körperpflege und Kosmetik
- Kommunikation (Umgang mit Behörden, Zahlungsmittel, Formulare, Banken),
- Medien (spezielle Hilfsmittel, Lesegeräte, Telekommunikation),
- Gesellschaftliche Organisations- und Umgangsformen
Cory (2020) beschreibt folgende Voraussetzungen für als Gelingensfaktoren für den Erwerb Lebenspraktischer Fähigkeiten:
- begriffliche Vorstellungen der Person mit Blindheit oder Sehbeeinträchtigung stimmen weitestgehend mit der Realität überein
- Zusammenhänge zwischen eigenem Tun und Handlungsergebnissen werden erkannt
- die Motivation, lebenspraktische Probleme zu lösen, ist gekoppelt mit Erfolgserwartung
- (fein-)motorische Fertigkeiten
- Fähigkeiten, sich im Handlungsraum zu orientieren
- Arm- und Handbewegungen und manuelle Teilfertigkeiten können koordiniert werden
Bei der konkreten Umsetzung des Unterrichts in LPF oder der zu erwerbenden Strategien ist es wesentlich, die individuelle Lernausgangslage der Schüler:innen zu beachten, wie beispielsweise kognitive oder motorische Einschränkungen. Dementsprechend müssen die Techniken oder die Genauigkeit der Ausführung der Handlungen angepasst werden, so dass die Kinder und Jugendlichen mit weiteren Beeinträchtigungen ebenfalls erfolgreich zum Ziel gelangen.
Cory (2020) stellt dazu ein Modell der Aufgabenanalyse und ihre individuelle Anpassung vor:
 Zitiervorschlag: „Aufgabenanalyse Lebenspraktische Fähigkeiten“ von Cory, P. (2020). Abgerufen von URL: https://wsd-bw.de/doku.php?id=wsd:selbstaendiges_leben:wsd:selbststaendiges_leben:themenfeld:bildungsangebote_versorgung:lpf
Zitiervorschlag: „Aufgabenanalyse Lebenspraktische Fähigkeiten“ von Cory, P. (2020). Abgerufen von URL: https://wsd-bw.de/doku.php?id=wsd:selbstaendiges_leben:wsd:selbststaendiges_leben:themenfeld:bildungsangebote_versorgung:lpf
Wenn in der jeweiligen Einrichtung keine Rehalehrkräfte für LPF beschäftigt sein sollten, können freiberuflich tätige Rehalehrkräfte diese Aufgabe übernehmen.
Die Kosten für diese Schulung werden u.a. vom zuständigen Sozialhilfeträger - im Rahmen der Eingliederungshilfe für Behinderte entsprechend dem Sozialgesetzbuch IX - übernommen. Dies geschieht bei Schulkindern unabhängig von den Einkommens- und Vermögensverhältnissen der Eltern.
Beim Erwerb Lebenspraktischer Fähigkeiten muss nach Cory (2020) im Rahmen der Vorüberlegungen entschieden werden, welche Ausführungsmethoden für eine Alltagshandlung ausgewählt wird.
Die nicht-visuelle Ausführungsmethode sollte hierbei:
- so sicher und ungefährlich wie möglich sein
- zuverlässig sein und möglichst immer zum Ziel führen
- so einfach wie möglich sein
- so weit wie möglich an sehende Normen angelehnt sein, um unnötiges Auffallen zu vermeiden
- nicht übertrieben zeit- und/oder energieaufwändig, also so ökonomisch wie möglich sein
- die Übertragbarkeit auf ähnliche Situationen berücksichtigen
- so „real wie möglich sein“ (kritisch hinterfragen, wann ein Hilfsmittel tatsächlich benötigt wird)
Die folgenden Filme aus dem häuslichen Alltag verdeutlichen, welchen Aufwand Tätigkeiten in diesem Bereich bei wegfallender visueller Steuerung erfordern:
Zitiervorschlag: Video „Einschenken“ der Schlossschule Ilvesheim (2021). Abgerufen von URL: https://vimeo.com/501681924
Zitiervorschlag: Video „Brötchen bestreichen“ der Schlossschule Ilvesheim (2021). Abgerufen von URL: https://vimeo.com/501679855
Literatur
Ministerium für Kultus, Jugend und Sport (2011). Bildungsplan der Schule für Blinde und Schule für Sehbehinderte. Stuttgart.
Cory, P. (2020). Mit Sehbeeinträchtigung im Alltag klarkommen. München: Reinhardt.
Walthes, R. (2005). Einführung in die Blinden- und Sehbehindertenpädagogik. München, Basel: Reinhardt.
Hergert, A. & Hofer, U. (2011). Förderung Lebenspraktischer Fähigkeiten. In: Lang, M., Hofer, U. & Beyer, F. (Hrsg). Didaktik des Unterrichts mit blinden und hochgradig sehbehinderten Schülerinnen und Schülerin. Band 2. Fachdidaktiken. Stuttgart: Kohlhammer.
Layout und Gestaltung: Christian Albrecht, Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung (ZSL) Baden-Württemberg